Wer sich für die Rückstände von Medikamenten im Abwasser interessiert, findet wohl kaum einen interessanteren Standort in Hamburg als das Universitätsklinikum Eppendorf (UKE). Drei Jahre haben unsere Kollegen Lukas Cordts und Dr. Thomas Werner in Kooperation mit dem Krankenhaus und Forschenden der Hamburger Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW) einen Teil von dessen Abwasserstrom untersucht.
Aus Sicht der Abwasserprofis sind vor allem Rückstände von Medikamenten interessant, sogenannte Spurenstoffe. Sie gelangen durch falsche Entsorgung oder Ausscheidungen ins Abwasser und so auch in die Gewässer. So war es bisher. Denn die Anfang 2025 in Kraft getretene EU-Abwasserrichtlinie KARL fordert Kläranlagen auf, Medikamentenrückstände in Zukunft mit einer vierten Reinigungsstufe zu reduzieren.
Mini-Klärwerk im Container
Die überwiegenden Kosten der aufwändigen Reinigung sollen dabei jedoch nicht die Gebührenzahler belasten, sondern von den Herstellern getragen werden. Bis 2027 soll die Richtlinie in deutsches Gesetz überführt sein.
Zum Interview treffen wir Dr. Thomas Werner und Lukas Cordst in dem blauen Forschungs-Container am Taxistand des UKEs. Im Innern steckt eine Kläranlage im Miniaturformat, ausgelegt für das Abwasser von rund 15 Menschen.
Sie haben drei Jahre das Abwasser des UKEs untersucht: Was haben Sie gefunden?

Dr. Thomas Werner: Einen wahren Datenschatz und eine Grundlage für die weitere Arbeit. Wir haben insgesamt 600 Analysen gemacht und auf 31 Medikamentenrückstände untersucht. Auffällig war, dass wir bei einigen Medikamenten eine geringere Konzentration vorgefunden haben als bei Proben im Zulauf zu unserem Klärwerk im Hamburger Hafen. Dazu gehören unter anderem die häufig in Haushalten eingesetzten Schmerzmittel Ibuprofen und das unter anderem in Salben genutzte Diclofenac. Andere Stoffe, wie bestimmte Antibiotika und Röntgenkontrastmittel waren dagegen im Krankenhausabwasser deutlich höher zu finden.
Welche neuen Verfahren wurden genutzt? Konnten die Spuren entfernt werden?
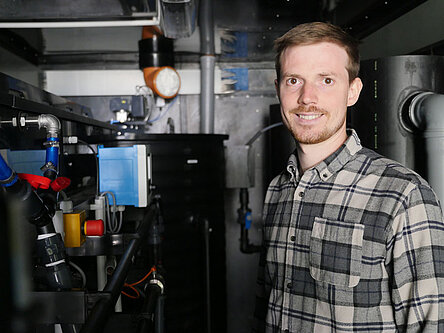
Lukas Cordts: Wir haben etwa mit der Zugabe von Aktivkohle gearbeitet. Dabei werden Spurenstoffe gebunden, ein Verfahren mit sogenannter Adsorption. Um die Filterleistung zu verbessern haben wir außerdem mit Membranen gearbeitet, mit der Ultrafiltration und Nanofiltration. Die kann man sich wie ein Sieb vorstellen, nur sehr viel kleiner.
Werner: Bei einigen Stoffen hat das sehr gut funktioniert, bei anderen müssen wir weiter Forschung anschließen. Resistente Keime, die sich die Fachleute vom UKE genauer angeschaut haben, konnten bei der Membranfiltration zum Beispiel deutlich besser als mit Sand- oder Aktivkohlefilter eliminiert werden.
Für die Reduktion von Medikamentenrückständen waren die Ergebnisse deutlich besser als bei einer reinen biologischen Reinigung. Gut die Hälfte der Konzentration konnten wir bereits biologisch entfernen. Durch die Nachreinigung waren höhere Eliminationen möglich. Es wird aber große Anstrengungen erfordern, wenn wir die von der KARL gefordert 80 Prozent der Spurenstoffe sicher herausfiltern wollen. Die Verfahren sind zudem sehr aufwendig. Daher ist die in der KARL verankerte Herstellerverantwortung so wichtig.
Die Kommunalabwasserrichtlinie KARL verpflichtet Hersteller von Kosmetika und Medikamenten dazu, einen Großteil der Reinigungs-Kosten zu übernehmen. Dass soll Anreize schaffen, die Schadstoffe an der Quelle zu minimieren...
Cordts: Das Thema Spurenstoffe wird uns auch weiterhin beschäftigen, gerade mit Blick auf eine immer älter werdende Gesellschaft und dem daraus resultierenden erhöhten Medikamentenbedarf. Unser Ziel ist es die Mikroschadstoffe durch neuartige Behandlungsverfahren zu reduzieren.
Der Container wird jetzt abgebaut, wie geht es weiter?
Werner: Die Ergebnisse liefern wichtige Anhaltspunkte für die Ausbauplanung des Klärwerks Hamburgs. Für weiterreichende Rückschlüsse der Behandlung der Stoffe sind weitere Untersuchungen in Hamburg erforderlich, die bereits in Folgeprojekten Anschluss finden. Den Container stellen wir dazu jetzt an unserem Klärwerksstandort Dradenau auf und setzen die Forschung fort.
Medizin und Umweltwissenschaft an einem Strang – „One-Health“-Ansatz

Abspielen externer Medien
Das Video kann erst abgespielt werden, wenn Sie der Nutzung von externen Medien zustimmen.
Das Forschungsprojekt folgt dem Leitgedanke des One-Health-Ansatzes. Der basiert auf dem Verständnis, dass die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt eng miteinander zusammenhängt und soll besonders den interdisziplinäre Austausch von Medizin und Umweltwissenschaften fördern.
Hintergründe zu dem Vorhaben erfahren Sie in unserem Film. Weitere Informationen zum Thema One Health auf der Website des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).



